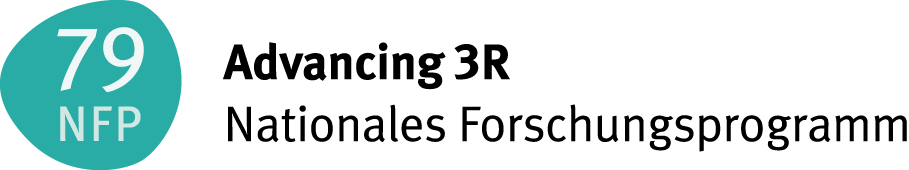Ein guter Tod? Wie Tierpflegende mit der Last der Euthanasie umgehen

Ein kürzlich durchgeführter Workshop zum besseren Verständnis der Euthanasie bei Nagetieren vereinte die Perspektiven von Tierpflegenden, Forschenden und Tierärzten, um die psychischen Belastungen besser zu verstehen.
In der Schweiz werden jedes Jahr Millionen von Nagetieren im Rahmen von Tierversuchen oder als überzählige Tiere mit CO2 getötet (euthanasiert). Diese Methode wird zunehmend kritisiert, da sie bei den Tieren möglicherweise Schmerz, Angst und Atemnot verursacht, bevor sie das Bewusstsein verlieren. Neben den Belastungen für die Tiere ist die Euthanasie auch eine erhebliche psychische Herausforderung für die Tierpflegenden. Das Projekt von Sonja Hartnack und ihrem Team hat das Ziel, ethisch fundierte Kriterien zur Beurteilung von Euthanasierungsmethoden zu entwickeln und Interventionsstrategien zu erarbeiten, die das Wohlbefinden von Labortieren und Tierpflegenden verbessern. Zudem geht es darum, die Resilienz von Tierpflegenden zu stärken und die Qualität und Ethik der Euthanasiepraxis zu verbessern.
Sie haben kürzlich einen Workshop zur Verfeinerung der Euthanasie bei Nagetieren durchgeführt. Was waren Ihre Eindrücke und gibt es schon zentrale Erkenntnisse?
Der Workshop war Teil einer vierteiligen Reihe, die wir gemeinsam mit einer evangelischen Theologin und Pflegefachfrau durchgeführt haben, die Erfahrung in der Begleitung sterbender Menschen mitbringt. Ziel war es, die Perspektiven von Tierpflegenden, Forschenden und Tierärzten zu sammeln, insbesondere im Umgang mit moralischem Stress – also den psychischen Belastungen, die entstehen, wenn ethische Konflikte bei der Euthanasie auftreten.
Wir haben verschiedene Methoden genutzt wie Rollenspiele, Zeichnungen und Gruppendiskussionen, um Erfahrungen und Emotionen zu erfassen. Dabei wurde auch Wert darauf gelegt, den Teilnehmenden während des Workshops Impulse zur Resilienzentwicklung zu geben, beispielsweise durch kollegiale Fallbesprechungen oder strukturierte Austauschmöglichkeiten.
Wichtig war, die Belastungen der Tierpflegenden zu verstehen, denn die Pflegenden sind direkt und stark betroffen. Das kann ihre Fähigkeit beeinträchtigen, die 3R-Prinzipien in Tierversuchen umzusetzen.
Zentrale Themen im Workshop waren zum Beispiel die Frage nach einem guten Tod, die Bedeutung von Zeit und respektvollem Umgang bei der Euthanasie, das Gefühl mangelnder Sinnhaftigkeit, wenn der Grund für die Euthanasie nicht nachvollziehbar ist oder auch die Selbstwahrnehmung der Tierpflegenden, die oft gesellschaftlich stigmatisiert werden. Besonders belastend empfanden manche Tierpflegenden Situationen, in denen z. B. ganze Tierfamilien getötet werden mussten, aber auch die fehlende Erreichbarkeit von Forschenden in akuten Situationen.
Welche Personen haben am Workshop teilgenommen und wie haben deren Perspektiven das Projekt bereichert?
Vor allem Tierpflegende, Forschende sowie Labortierärzte haben teilgenommen. Während des Workshops wurde deutlich, dass viele Forschende bislang kaum Einblick in die Sichtweise und die Herausforderungen der Tierpflegenden hatten. Ebenso war es für die Pflegenden oft neu, die Perspektiven und Zwänge der Forschenden zu verstehen. Dieser Austausch führte zu einem besseren gegenseitigen Verständnis.
Der Workshop zeigte auch, dass gerade junge Forschende häufig unter erheblichen Rollenkonflikten leiden, etwa wenn sie von Vorgesetzten gedrängt werden, Tierversuche oder Euthanasien schnell durchzuführen, dabei aber noch nicht ausreichend eingeführt oder begleitet wurden.
Der Workshop half, diese unterschiedlichen Perspektiven sichtbar zu machen und den Dialog zwischen den Gruppen zu fördern. So konnten die Teilnehmenden besser nachvollziehen, welche ethischen und praktischen Schwierigkeiten die jeweils andere Gruppe erlebt.
Wie ist der aktuelle Stand Ihres Forschungsprojekts?
Paralell zu den vier Workshops bereiten wir eine Pilotstudie vor, in der wir die sogenannte Eye-Tracking-Technologie einsetzen: Ein Verfahren, das die Augenbewegungen einer Person erfasst und auswertet, um daraus Rückschlüsse auf ihre Aufmerksamkeit, ihre Denkprozesse und ihre Entscheidungsfindungen zu gewinnen. Unser Ziel ist, zu analysieren, wie Fachpersonen visuell und emotional auf Videos von Euthanasien reagieren.
Ausserdem planen wir eine umfangreiche internationale Online-Studie zur Entwicklung eines validierten Fragebogens zum Thema moralischer Stress, um die Belastungen systematisch zu erfassen und besser zu verstehen.
Wir befinden uns aktuell in der Phase der Datenanalyse und Instrumentenentwicklung mit dem Ziel, die nächsten Schritte im kommenden Jahr umzusetzen und die Ergebnisse danach zu publizieren. Die Projektlaufzeit ist bis mindestens Ende 2026 geplant.
Welche Schritte sind geplant, um die Erkenntnisse aus dem Projekt in der Praxis umzusetzen?
Wir planen, die Ergebnisse aus der Eye-Tracking-Studie und der Online-Befragung zu nutzen, um konkrete Interventionen zu entwickeln. Ein Schwerpunkt wird darauf liegen, die Einführung und Begleitung von Fachkräften im Bereich Euthanasie besser zu gestalten, beispielsweise durch strukturierte Schulungen, Supervision und den Aufbau von kollegialen Austauschformaten.