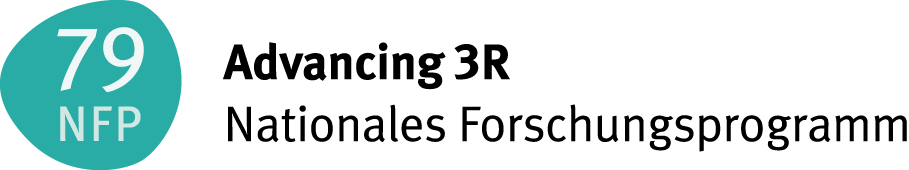Impulse für die Zukunft der Forschung mit Tieren

Am 27. November 2025 veranstaltet das NFP 79 in Bern ein Symposium zur Zukunft der tiergestützten und 3R-Forschung in der Schweiz. Herwig Grimm gibt vorab Einblicke in den Beitrag der Wissenschaft zum gesellschaftlichen Dialog.
Wie könnte es weitergehen mit der Forschung mit Tieren in der Schweiz? Welche Strategien gibt es und welche Vor- und Nachteile haben sie? Wie entwickelt sich die EU oder die USA in dieser Frage und welche Auswirkungen hat dies auf die Schweiz? Am 27. November 2025 organisiert das NFP 79 in Bern ein wissenschaftliches Symposium zur Zukunft der tiergestützten Forschung und der 3R-Forschung in der Schweiz. Eingeladen sind Expertinnen und Experten aus der Forschung, der Verwaltung, der Industrie wie auch von NGOs aus der Schweiz und der EU.
Herwig Grimm, Präsident der Leitungsgruppe, ordnet im Vorfeld des Symposiums aktuelle Entwicklungen rund um Tierversuche ein und erläutert, welchen Beitrag die Wissenschaft zu einem informierten gesellschaftlichen Dialog leisten kann.
Herr Grimm, was macht das Symposium vom 27. November gerade jetzt besonders relevant – für die Schweiz, aber auch im internationalen Kontext?
Derzeit ist deutlich spürbar, dass die Debatte rund um Tierversuche in Bewegung geraten ist – national wie international. In den USA plant die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA den Ausstieg aus verpflichtenden Tierversuchen bei der Entwicklung monoklonaler Antikörpertherapien und anderer Medikamente. In der EU wird eine «Roadmap» zur schrittweisen Abschaffung der tierexperimentellen Forschung erarbeitet. Die Niederlande investieren über den «Dutch National Growth Fund» 125 Millionen Euro in den Übergang zu tierfreien Innovationsmethoden. Und auch in der Schweiz wird derzeit die nächste Volksinitiative zu einem möglichen Verbot von Tierversuchen vorbereitet.
All diese Entwicklungen zeigen: Die Frage, wie es mit der biomedizinischen Forschung weitergehen soll, stellt sich mit neuer Dringlichkeit – auch für die Schweiz. Das Symposium am 27. November bietet einen Rahmen, um diese Dynamik aufzugreifen und den Dialog über zukunftsfähige Forschung mitzugestalten.
Was kann mit dem Symposium am 27. November erreicht werden?
Tierversuche sind ein vielschichtiges, gesellschaftlich sensibles Thema. Mit dem Symposium möchten wir – auf Grundlage der bereits erarbeiteten Ergebnissen aus dem NFP 79 sowie der Expertise ausgewiesener Fachpersonen – einen Überblick über aktuelle Möglichkeiten, Herausforderungen und künftige Szenarien geben. Damit greifen wir das Kernanliegen des NFP auf: Wissenschaftlich informiert, interdisziplinär und am Puls der Zeit über gesellschaftlich relevante Fragen nachzudenken – und so den Dialog aktiv mitzugestalten.
Inwiefern kann wissenschaftliche Evidenz politische oder gesellschaftliche Entscheidungsprozesse beeinflussen – gerade bei einem emotional aufgeladenen Thema wie Tierversuchen?
Gerade weil das Thema vielerorts emotional und kontrovers diskutiert wird, tut die Reflexion über unterschiedliche Gestaltungsoptionen für die Zukunft der Forschung in einem moderierten Rahmen besonders gut. Wissenschaft produziert Wissen – und Politik entscheidet, wohin die Reise geht. Damit politische Entscheidungen fundiert getroffen werden können, ist es wichtig, Wissenschaft und Politik zusammenzubringen und aufzuzeigen, was auf dem Spiel steht und was unter welchen Rahmenbedingungen möglich ist. Letztlich sind es politische Entscheidungen, die die Richtung vorgeben. Wissenschaft kann dabei helfen, die möglichen erwünschten und unerwünschten Konsequenzen dieser Entscheidungen aufzuzeigen und zu klären, welche Rahmenbedingungen nötig sind, um voranzukommen.
Was kann das NFP 79 konkret zur Frage der künftigen Ausrichtung der Tierversuche und 3R-Forschung in der Schweiz beitragen?
Ich denke, dass das NFP 79 bereits nach drei Jahren Forschungsphase deutlich gemacht hat, dass die Auseinandersetzung über die Verwendung von Tieren zu wissenschaftlichen Zwecken differenzierter geführt werden muss als bisher. Plakative Ja-Nein-Antworten führen nicht weiter. Zielführender ist es, konkret Bereiche zu identifizieren, in denen Potential für tierfreie Forschung besteht – und dafür kontextspezifische, wirksame Strategien zu entwickeln. Ein Beispiel dafür ist das Verbot der Testung von kosmetischen Produkten an Tieren auf EU-Ebene. Dies ist grundsätzlich geglückt. Das Erfolgsrezept war ein Zusammenspiel von politischem Willen, wissenschaftlichen Alternativen und Organisationen, die sich für das Verbot einsetzten.
Welche Themen sind in der Forschung weitgehend anerkannt, stossen aber gesellschaftlich noch auf Widerstand?
Auch hier scheint mir eine einfach Antwort der Komplexität des Themas nicht gerecht zu werden. Der gesellschaftliche Stellenwert von Wissen und Wissensproduktion wird heute von weiten Teilen der Bevölkerung nicht mehr als besonders hoch eingeschätzt – um nicht zu sagen: zunehmend geringgeschätzt. Auf der anderen Seite hat sich die Schweiz – etwa mit der «Würde des Tieres» oder einem ambitionierten Tierschutzrecht – das Ziel gesetzt, Tiere nur im Ausnahmefall für fremde Zwecke Belastungen auszusetzen und zu instrumentalisieren.
Ich denke, dass gerade das Zusammenspiel dieser beiden Entwicklungen – das schwindende Vertrauen in die Wissenschaft und das zunehmende Bewusstsein für den rechtlich geschützten Eigenwert von Tieren – die teils sehr emotionale Debatte um Tierversuche besser erklärt als ein rein tierschutzethisches Argument allein. Insofern werden Tierversuche auch zu einer Projektionsfläche für die Debatte darüber, welche Rolle Wissenschaft in unserer Gesellschaft spielt und in welchem Verhältnis ihr Wert zu anderen gesellschaftlichen Zielen wie etwa dem Tierschutz steht.
In welchen Bereichen sehen Sie in den kommenden Jahren in der Schweiz den grössten Handlungsbedarf?
Ein zentraler Handlungsbedarf liegt darin, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die interdisziplinäre 3R-Forschung langfristig und strukturell unterstützt wird. Dieses Forschungsfeld sollte attraktiv für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein. Dazu gehören auch Karrierewege. Zudem sollte die 3R-Forschung nicht zu eng gefasst werden: Wissenschaftliche Innovation, Implementierungstrategien sowie die gesellschaftliche Debatte sollten systematisch und wissenschafltich verknüpft werden. Dass dies funktionieren kann, zeigt das NFP 79 jetzt schon.
Weiterführende Informationen und Updates zu den Projekten sind auf der offiziellen Webseite des NFP 79 sowie über Newsletter und Social-Media-Kanäle verfügbar.